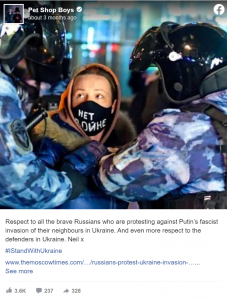Was treibt die Pet Shop Boys an, seit über 30 Jahren intelligenten Pop zu machen und nun das mittlerweile 13. Album »Super« zu veröffentlichen? Porträt einer erst auf den zweiten Blick subversiven Band.
Neil Tennants Karriere als Popstar begann mit seinem Nachruf. Der erschien 1985 in der britischen Zeitschrift Smash Hits. »Du wirst in ein paar Monaten auf Knien zu uns zurückgerutscht kommen«, hieß es darin spöttisch. Die Autoren dieser Zeilen wahren: seine Journalistenkollegen bei der Pop-Postille. Tennant hatte gerade mit dem fünf Jahre jüngeren Chris Lowe seinen ersten Plattenvertrag bei Parlophone unterschrieben und sich gegen einen sicheren Job als Redakteur entschieden. Ein Glück für die Musikgeschichte, dass die Smash Hits-Leute Unrecht behalten sollten.
Wenn Tennant, inzwischen 61, diese Anekdote heute, 31 Jahre später, auf BBC Radio 2 erzählt, lacht er selbst über seine damalige Naivität. Als halte er es immer noch für absurd, dass er, der schlaksige, homosexuelle, nordenglische 30jährige eines Morgens bei einer Tasse Earl Grey beschloss, Popstar zu werden. Diese Haltung sagt viel aus über das Konzept dieser Band, die als »The Smiths zum Tanzen« bezeichnet wurden: selbstironischer Intellekt meets Clubbing. So kann man auch die Philosophie des mittlerweile 13. Albums »Super« beschreiben. Auf dem minimalistischen Cover des Designers Mark Farrow, der bei der berühmten Factory in Manchester begann und ein langjähriger Weggefährte des Duos ist, steht der gelbe Schriftzug »Super« auf pinkfarbenem Grund, was dem Logo eines Markenproduktes ähnelt. Tennant und Lowe haben das Warhol-Prinzip verinnerlicht: Nimm ein banales Massenprodukt wie Campbell’s Suppendose und transformiere es ironisch in ein Kunstobjekt. Oder, um es wie der Poptheoretiker George Melly in »Revolt into Style« zu formulieren: Instrumentalisiere Stil als Widerstandsform. Das schlug sich bei den Pet Shop Boys schon in experimentellen Arbeiten nieder, wie der Oper »A Man from the Future« über den Mathematiker Alan Turing, der wegen seiner Homosexualität verhaftet wurde und sich 1954 das Leben nahm, oder einem Soundtrack zu Sergej Eisensteins Stummfilm »Panzerkreuzer Potemkin«.
Was haben sie nicht noch alles ausprobiert: Italian Discopop (im Song »Paninaro«), pulsierenden Eurotrash, eine fußballstadiontaugliche Schwulenhymne (das Village-People-Cover »Go West«), Cover-Versionen von U2 über Coldplay bis Blur, musikalische Kollaborationen mit Dusty Springfield, Liza Minelli oder David Bowie, einen Spielfilm (»It Couldn’t Happen Here«), etliche Clubbing-Alben wie »Introspective« und »Relentless«, ein Ballett (»The Most Incredible Thing«).
»Super« ist eine gute und dancefloororientierte Platte geworden und passt zum Vorgängerwerk »Electric«: ein Bekenntnis zu Kontinuität statt Neuerfindung. »Seht her, wir sind tanzbar«, ruft es aus jedem Song. »Business as usual«, werden Ignoranten gähnen. Das Motto »More banging, more lasers« regiert die meisten Uptempo-Tracks auf dem Album. Es gibt das sakral-elektronische, an Faithless erinnernde »Inner Sanctum«, das ganz auf die Ekstase des Moments setzt, und die Hands-up-in-the-air-Kracher »Burn« und »Say It to Me«. Es gibt eine wehmütige Ode an das untergegangene Soho, gleichzeitig eine Spitze gegen die heutige Yuppie-Dominanz in der Finanzkapitale London (»Twentysomething«). Es gibt eine melancholische Ballade (»Sad Robot World«), zu der Tennant allen Ernstes von der Besichtigung eines Volkswagen-Werks in Frankfurt inspiriert wurde. Es gibt einen Hauch von Diskurs im üppig arrangierten »The Dictator Decides«, eine Persiflage auf die Putins und Assads unserer Zeit: »The joke is I’m not even a demagogue. Have you heard me giving a speech? My facts are invented. I sound quite demented.« Und es gibt kristallklaren 80s-Pop im besten Track »Pop Kids«, der eine Liebesgeschichte im London der Neunziger zelebriert: »We were young but imagined we were so sophisticated. Telling everyone we knew the rock was overrated«, heißt es da. Die Abgrenzung vom maskulinen Rock ist für die Pet Shop Boys Manifest, war ihre Identität doch seit jeher queer. Sei es im frühen Video »Was It Worth It«, in dem Travestiekünstler tanzen, oder im Make-up für Shootings und Gigs der frühen Tage, konzipiert von Pierre LaRoche, der Bowies »Aladdin Sane«-Look schuf. Ihre Ästhetik, ihre Liveaufritte sind ein Widerspruch zu üblichen Männlichkeitsriten im Rock.
Das Duo hat sich zudem schon immer auf interessante Weise mit der Thematik Künstlichkeit versus Authentizität beschäftigt, einem Urtopos des Pop. Das gipfelte in zeitweiligen Überlegungen, sich ähnlich wie bei Damon Albarns Projekt »Gorillaz« in der Öffentlichkeit von Robotern ersetzen zu lassen. Daraus wurden letztlich nur karnevaleske Verkleidungen, getreu dem Motto ihres Vorbildes Noel Coward: »Wir alle tragen Masken als Schutz. Das moderne Leben zwingt uns dazu.«
Die Pet Shop Boys widersetzen sich, obwohl Tenannt und Lowe homosexuell sind, bis heute vehement dem Label, eine schwule Band zu sein. »Universalisten, die nicht von einer Gruppe vereinnahmt werden wollten«, nennt sie der Londoner Autor Ramzy Alwakeel. Er hat über die Pet Shop Boys gerade das Buch »Smile if you dare« geschrieben. »Sie wollten nie als speziell politischer Akt gesehen werden«, auch wenn es natürlich gesellschaftskritische Aspekte gebe, etwa 1987 auf dem Album »Actually«, einer Attacke auf den Thatcherismus. Viele ihrer Songs behandelten zudem das Thema Aids und kritisierten dabei indirekt strukturelle Homophobie. In dieser »Politik des Persönlichen« gehe es durchaus auch um den Kampf gegen die Unterdrückung homosexueller Menschen und das Bedauern über die schwindende Subversivität des schwulen Unterground, sagt Alwakeel. »Das macht sie aber nicht zu Protestsängern.«
Aber zu Künstlern, denen der Diskurs am Herzen liegt. »Wir stammen aus der Mittelschicht und gleichzeitig greifen wir diese Lebensweise an«, hat Tennant mal gesagt. Ebenso gern entlarven sie die hohle Scheinwelt der Superreichen wie im Song »Love etc.« von 2009, einem Abgesang auf den Kapitalismus: »You need more than Gerhard Richter hangin’ on your wall and a chauffeur driven limousine on call.« Das geht gegen eben jene Milliardäre, die London aufkaufen, den Sehnsuchtsort, in den die Pet Shop Boys einst aus der Provinz pilgerten, aus Furcht, ein langweiliges Vorstadtleben zu führen und an dem sie immer noch wohnen. Tennant kommt aus Newcastle, Lowe aus Blackpool. In letzterem, einem vergilbten Seebad, verrostet am Meer die Achterbahn des Vergnügungsparks »Pleasure Beach«, die Lebenserwartung ist geringer, der Drogen- und Alkoholkonsum größer als in anderen britischen Städten. Man sieht die Verlierer des Klassensystems des Vereinigten Königreichs, wo die Garantie für sozialen Status immer noch der Besuch einer Privatschule oder -universität mit horrenden Gebühren ist. Fußballer oder Popstar zu werden seien für ihn die einzigen Möglichkeiten gewesen, der Armut in Manchester zu entrinnen, erinnerte sich einst Großmaul Noel Gallagher. Ein Spruch, der ein wenig auch auf die Pet Shop Boys zutrifft, die nach drei Jahrzehnten in der glamourösen Popwelt immer noch das Privileg zu stimulieren scheint, einem kreativen Beruf nachgehen zu dürfen. Möglicherweise pflegen sie deshalb eine so bodenständige wie höfliche Haltung: In Interviews sind Tennant und Lowe die entzückendsten Gesprächspartner, die ein Journalist such erträumen kann. Sie gehörten zu der Kategorie Prominente, die auch dann noch smart antworten, wenn sie eine Frage schon hunderte Male beantwortet haben. Inklusive der Weigerung, mit privaten Details herauszurücken. So sind Tennant und Lowe Popbeamte im positiven Sinne: Sie arbeiten fleißig, ja fast schon besessen, auf hohem Niveau. Und das vermutlich auch noch, wenn sie 70 sind.
Aus: Jungle World
Von: Annette Walter