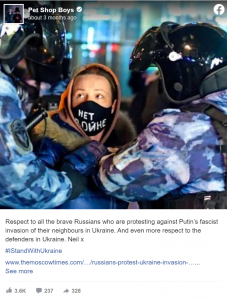Sie beklagten ihn zuletzt gerne und ausführlich, den Niedergang der Populärkultur im Allgemeinen und der britischen Popmusik im Speziellen. Umso erstaunlicher war es, dass die Pet Shop Boys im letzten Jahr einen Song für die britische Retortenband Girls Aloud schrieben – und ‘Yes’, ihr neues und zehntes Studioalbum von deren Produzententeam Xenomania inszenieren ließen. Nun waren die Pet Shop Boys, sieht man vom etwas blassen ‘Release’ ab, eine Band, die es stets schaffte, modern zu klingen. Wie geschickt diesmal die Grenzen zwischen organischen und opulent geschichteten Größenwahn-Stücken auf der einen und eher kühlen Popsongs auf der anderen Seite ausgelotet werden, ist aber dennoch bemerkenswert und macht ‘Yes’ zum besten Album seit dem oft unterschätzten Großwerk ‘Very’. Grund genug für ein Gespräch über Pop, Geld und bizarre Konzerterlebnisse.
jetzt.de: Herr Tennant, Herr Lowe, als ich neulich mit Alex Kapranos von Franz Ferdinand über perfekte Popsongs sprach, fiel unter anderem der Name Ihrer Band. Nach 25 Jahren im Geschäft: Schmeichelt Ihnen so etwas noch?
Neil Tennant: Ich habe gehört, dass sie uns mögen. Und natürlich freut es mich, auch wenn ich Franz Ferdinand nicht unbedingt mit den Pet Shop Boys in Verbindung gebracht hätte. Das ist ohne Frage eine gute Band, aber ich denke bei denen nicht in erster Linie an Melodien. Sie funktionieren anders, eher über Riffs. Aber jemand anderes, der sich immer wieder auf uns beruft, ist Brandon Flowers von den Killers, wirklich ein feiner Kerl. Ich habe mich erst neulich mit ihm unterhalten, und er sagte, dass viele Journalisten der Meinung wären, ‘Human’ wäre ein Song, der auch von uns sein könnte. Ich bin natürlich ganz und gar nicht dieser Meinung, was ihn fast ein bisschen zu enttäuschen schien.
Woran liegt es, dass der Synthiepop der frühen Pet Shop Boys aktuell so oft als Einfluss genannt wird? Eine Zeitgeistsache?
Neil Tennant: Es kann sein, dass das eine Zeitgeistsache ist, ja. Viele Bands verwenden momentan Synthies. Wenn ich britische Musikzeitschriften wie die Q oder die Uncut aufschlage, finde ich spätestens in der fünften oder sechsten Plattenrezension einen Verweis auf die Pet Shop Boys. So schmeichelhaft das sein mag, ich glaube, das liegt aber oftmals gar nicht so sehr am Sound und vor allem nicht daran, dass wir so viele Spuren hinterlassen haben – sondern eher an der Tatsache, dass viele Musikjournalisten im Eighties-Pop nicht besonders sattelfest sind. Die hören ein Keyboard und denken, hey: die Pet Shop Boys.
Ihr neues Produzententeam Xenomania arbeitete viel mit Girls Aloud – für die wiederum sie zuletzt einen Song schrieben. Ein Versuch, nach der Zusammenarbeit mit dem sehr etablierten Produzenten Trevor Horn diesmal als modern rezipiert zu werden?
Neil Tennant: Wir waren schon immer eine Band, die sehr viel Wert auf die Melodien, auf die Refrains legte. Das ist nichts Neues, denke ich. Was uns aber durchaus interessiert, ist von Platte zu Platte eine neue Herangehensweise zu finden. Xenomania arbeiten komplett anders als wir, bei ihnen geht es eher um die richtigen Sounds, als um diese klassischen Strophe- / Refrain-Geschichten. Sie kümmern sich sozusagen um den Gesamtklang und passen den dann in die Songs ein. Was aber mindestens genauso wichtig war, war das Setting: Wir saßen in diesem Märchenhaus in der Nähe von Kent. Das ist das Haus, in dem die Vorlage für ‘Alice im Wunderland’ lebte, und die haben daraus wirklich etwas ganz Tolles gebaut. Es gibt unfassbar viele Räume, in denen überall wahnsinnig talentierte Menschen arbeiten – da ist zum Beispiel einer von den Typen dabei, die früher THE KLF waren, aber auch einer, der viel mit Daft Punk arbeitet. Im Speicher, im Keller, in jedem der hundert Räume sitzen Menschen und sind kreativ. Und im Wohnzimmer sitzt Brian von Xenomania, sammelt USB-Sticks ein und hält das irgendwie zusammen.
Was war der künstlerische Ansatz des Albums?
Neil Tennant: Schwer zu sagen. Aber es lagen am Anfang auf jeden Fall einige Songs herum, bei denen wir schnell an Xenomania dachten. Flotte, upliftige Stücke.
Es dürfte auch finanziell aufgehen – spielt so etwas bei Ihnen noch eine Rolle?
Neil Tennant: Oh, ich würde nicht sagen, dass die Wahl der richtigen Produzenten automatisch zu Erfolg führt. Und man darf nicht vergessen, dass Xenomania unabhängiger arbeiten als viele andere Produzenten. Man gibt da schon auch eine Menge Ideen in fremde Hände, was nicht ohne Risiko ist. Aber es hat sich gelohnt. Und im Übrigen: Es ging uns nicht um Geld. Es geht uns wirklich nie um Geld, das ist ein Gebiet, auf dem wir keinerlei Interessen verfolgen und um das wir uns auch nicht großartig kümmern. Wir waren nie eine absichtlich kommerzielle Band. Wir haben nie einen Song mit dem Augenmerk geschrieben, damit so richtig gut zu verdienen – auch wenn uns das zu ‘Go West’-Zeiten gerne vorgeworfen wurde.
Chris Lowe: Ich glaube im Übrigen, dass ein Engländer ein anderes Verhältnis zum Geld hat. Er weiß, dass er es sehr schnell wieder verlieren kann und tut genau das sehr gerne. Vor allem ist es ein anderes Verhältnis zum Erfolg. Egal, ob es um Musik geht, oder um Fernsehen oder um Sport. Wer erfolgreich ist, ist erst einmal verdächtig, das Herz der Briten gehört meistens denen, die es nicht so ganz hinbekommen oder sogar gnadenlos scheitern. Selbst bei jemanden wie Robbie Williams sind die Bruchstellen sehr deutlich. Das ist der große Unterschied zu Amerika. Dort können sich Stars so etwas nicht leisten. Nimm jemanden wie David Bowie. Der war pleite, als er nach Berlin kam. Oder New Order. Bernhard Summer erzählte mir einmal, wie ‘Blue Monday’ entstand: Sie versuchten, Sylvesters ‘You Make Me Feel (Mighty Real)’ nachzuspielen, kamen aber nicht mal bis zur Hälfte vom Refrain!
Konnten Sie den Vorwurf, kommerziell zu sein, denn nachvollziehen?
Neil Tennant: Nein! Damals war es tatsächlich das, auf das wir Lust hatten. Wir mögen Popsongs mit einer starken Melodie, das ist ganz genau das, worum es bei den Pet Shop Boys geht. Und das ist im Übrigen eine Sache, die sich nicht mehr ändern wird, so weit ich das überblicken kann. Natürlich könnten wir auch ein sehr experimentelles Album aufnehmen, vielleicht auch einmal etwas mit einem Kinderchor oder so. Dass wir das nicht tun, liegt schlichtweg an der Tatsache, dass wir keinerlei Bedürfnis danach haben.
Sie haben noch nie etwas ausschließlich fürs Geld getan? Andere spielen für Millionengagen auf Hochzeiten …
Neil Tennant: Doch, eine verrückte Sache gibt es da, und wir haben noch nie drüber geredet. Einmal spielten wir für eine sehr hübsche Summe Geld auf dem Empfang einer großen Molkereifirma in Moskau. Das war wirklich einigermaßen bizarr. Hinter der Bühne nahm uns der Veranstalter noch einmal zur Seite, sagte, wie großartig es wäre, dass wir hier spielen würden. Es wäre die Superüberraschung, er hätte niemandem Bescheid gegeben. Dann kamen wir auf die Bühne – und es waren vielleicht 60, 70 Leute da, alles russische Geschäftsleute. Die Hälfte von denen hing in ihren Stühlen und war einfach total besoffen. Vor der Bühne standen vielleicht 15 Zuschauer, während unseres Sets kamen noch einmal so viele ganz, ganz langsam nach vorne. Wir haben uns nur angeschaut und gewundert. Wenn man einmal bedenkt, was da für ein Aufwand dahinter steckte! Wir haben schließlich einen kompletten Bühnenaufbau nach Moskau eingeflogen, das hat die insgesamt ein paar Millionen gekostet.
Chris Lowe: Oh, ich würde übrigens gerne einmal auf der Hochzeit von Beyonce oder so spielen. Das hat aber leider noch nie jemand angefragt. Wir sollten vielleicht häufiger betonen, dass so etwas für uns durchaus in Frage käme. Ich denke, so etwas ginge in Ordnung, weil wir damit ja andere Dinge gegenfinanzieren. Mit Eisensteins ‘Battleship Potemkin’ haben wir keinerlei Geld verdient. Auf unserer ersten Tour versenkten wir 500.000 Pfund. Oder die Tour zu ‘Performance’, Anfang der 90er-Jahre: Das war wirklich eine Materialschlacht mit einem unfassbar komplizierten Set und sehr vielen Mitwirkenden. Damals hatten wir alleine zwei Leute, die sich um die Perücken gekümmert haben, ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat. Als wir Mitte der 90er-Jahre drei Wochen lang am Stück Abend für Abend im Savoy spielten, kostete uns das pro Zuschauer 15 Pfund. Wir hätten also genauso gut jedem 15 Pfund überweisen können. Oder das Geld einfach verbrennen. Wäre vielleicht besser gewesen. Bei Konzerten ist unsere Strategie heute eine ganz einfache: Bloß kein Geld verlieren.
Taken from: Jetzt.de
Interviewer: Jochen Overbeck