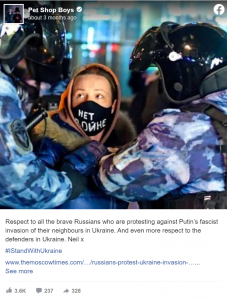Die klügsten Hedonisten des Pop haben die Sparsamkeit entdeckt. Im SPIEGEL-Interview kritisieren die Pet Shop Boys den schlechten Einfluss russischer Oligarchen und deutsche Ladenschlusszeiten – und sprechen über ihre Hoffnung, mit dem neuen Album ‘Yes’ Krisengewinner zu werden.SPIEGEL: Mr. Lowe, Mr. Tennant, in ‘Love etc.’, der ersten Single Ihres neuen Albums, singen Sie: ‘Man braucht kein Superauto, um es weit zu bringen/ Man braucht kein Leben der Macht und des Reichtums zu leben’. Ist das Pop in Zeiten der Rezession? Tennant: Das haben wir geschrieben, bevor die große Krise losging. Da blubberte sie gerade erst ein bisschen. Aber ja: Es ist falsch zu glauben, wir könnten uns aus der Krise herausshoppen. Es ist falsch, langweilig und unbefriedigend, dem Konsum und der Celebrity-Kultur eine derartig unglaubliche Wichtigkeit zuzusprechen, wie das in den letzten Jahren der Fall war. SPIEGEL: Pflegt die Popkultur nicht ein intimes Verhältnis zum Konsum? Tennant: Absolut. Aber man muss die Dinge auseinander halten. In den sechziger oder achtziger Jahren war es auch Teil des Pop, die Konsumkultur zu kritisieren, selbst wenn das oft ziemlich heuchlerisch schien. SPIEGEL: Damals hieß es in einem Ihrer Songs: ‘Lass uns eine Menge Geld verdienen.’ Lowe: (lacht) Ach, komm gelegentlich ein Sportwagen … SPIEGEL: In einer Umfrage hat unlängst eine Mehrheit der befragten Engländer auf die Frage nach ihrer Lieblingsbeschäftigung geantwortet: Shopping. Was ist schief gegangen im stolzen Britannien? Tennant: Wir waren schon immer die trashigeren Europäer. Ich glaube, dass sich der Begriff von Reichtum in den letzten Jahren grundlegend verändert hat. Das hat viel mit den Oligarchen aus der ehemaligen Sowjetunion zu tun, die sich mit ihren riesigen Vermögen in London niederließen. Diese Leute haben die kulturellen Maßstäbe für das verändert, was es bedeutet, reich zu sein. Auf einmal waren vormals reiche Leute nicht mehr reich. Hast du einen Privatjet? Hast du Milliarden oder nur Millionen? Kannst du dir einen Fußballclub kaufen? Solche Fragen hatten großen Einfluss in den Chefetagen von Großkonzernen und auf die Art und Weise, wie über die Wirtschaftswelt berichtet wurde. Auf einmal sah es so aus, als sei ein Unternehmen nur noch ein Spielzeug in den Händen einer Gruppe von cleveren Leuten an der Spitze. Und die vermittelten den Anschein, als sei das Unternehmen ohne sie nichts wert. SPIEGEL: Diese Entwicklung begann doch schon unter der liberalen Marktmissionarin Margaret Thatcher. Tennant: Nein, diese Geschäftskultur gab es in Großbritannien vorher nicht. Das fing in den Neunzigern an. Wenn man vorher Chef eines Großunternehmens war, hatte man ein Haus und eine Ferienwohnung und einen Rolls-Royce mit Fahrer. Das war eine andere Kultur als die der Neureichen. SPIEGEL: Die englische Elite hatte immer schon Stil? Tennant: Sicher. Aber das Faszinierende ist doch, wie der Rest der Öffentlichkeit anfing, sich an dieser neuen Kultur des Reichtums zu orientieren. Jeder ging shoppen, als wäre er reich. Überall hat sich etwa die Überzeugung durchgesetzt, dass man Kleidung nur noch für eine Saison kauft. Das ist ursprünglich ein Haute-Couture-Gedanke. Das haben die Leute früher nicht getan. Diesen kulturellen Gezeitenwechsel finde ich sehr ärgerlich. Was ist aus der guten alten Sparsamkeit geworden? SPIEGEL: Konsum ist Bestandteil der Globalisierung. Daran ist doch nicht alles schlecht. Die Reiselust zum Beispiel die Billigflieger haben Europa zusammengeführt.Tennant: Ich verstehe das Geschäftsmodell dieser Gesellschaften nicht. Ich habe mich vor einigen Jahren mit meiner Putzfrau gestritten, die sagte, sie würde für neun Pfund nach Prag fliegen. Ich habe gesagt, dass das verboten werden sollte. SPIEGEL: Aber die Städte sind wesentlich internationaler geworden. Tennant: Das stimmt. Die Briten mochten Fremde eigentlich nie. Wie die Deutschen, die den Ausländern ja auch nie viel abgewinnen konnten. Das ist heute anders. Ein Spanier kann in einem britischen Dorf herumspazieren, ohne für exotisch gehalten zu werden. Das ist eine große Errungenschaft. SPIEGEL: Der amerikanische Schriftsteller Jay McInerney hat vor kurzem geschrieben, er freue sich auf die Rezession, weil sie einen positiven Effekt auf die Kultur haben werde. Sehen Sie das auch so? Tennant: Das ist leicht gesagt, wenn man keine Geldprobleme hat. Lowe: Aber nicht für jemanden, der gerade seinen Job verloren hat. Das sind ja nicht nur ein paar Leute, ganze Regionen sind betroffen. SPIEGEL: Historisch waren wirtschaftlich schwierige Jahre, etwa zwischen den zwei Weltkriegen, oft kulturelle Blütezeiten. Lowe: Weil wir eskapistische Popmusik machen. Zu der man tanzen kann. Wenn die Geschäfte gut laufen, tendiert man eher zur Introspektion. Oder zum Aussteigen. Tennant: Die Hippies waren ja im Grunde ein Wohlstandsphänomen. Lowe: Ein anderes Beispiel: Disco. New York war eine bankrotte Stadt in den Siebzigern. Und hatte das beste Nachtleben, das man sich vorstellen kann, die beste Musik. Tennant: Wir haben in den vergangenen Jahren in einer Traumwelt gelebt und geglaubt, dass es ewig bergauf geht. Ich hoffe, die Leute kommen wieder in der Realität an. SPIEGEL: Haben die Charts mit dem Niedergang der Single-Platte an Bedeutung verloren? Tennant: Nein. Die Single ist zurück. Sie heißt nur Download. Das, was es nicht mehr gibt, ist eine Fernsehsendung wie ‘Top of the Pops’, in der die Charts gefeiert wurden. Wenn eine Sängerin wie Duffy heute auf Nummer Eins ist, so ist das kein Event mehr. Viele Popstars sind unsichtbar geworden. Ich weiß gar nicht, wie manche Stars aussehen, die in den vergangenen Jahren in den Charts waren. ‘Top of the Pops’ war die Krönungszeremonie, für die, die die Spitze der Charts erklommen hatten. Das gibt es nicht mehr. SPIEGEL: ‘Yes’ ist Ihr zehntes Studioalbum. Sie sind seit rund 25 Jahren im Geschäft. Wollen Sie noch mal an die Spitze? Tennant: Ja, sicher. SPIEGEL: Sind Sie deshalb mit dieser Platte zu dem Starproduzenten Brian Higgins gegangen? Tennant: Nein. Wir gehen zu einem Produzenten, weil wir Songs geschrieben haben und wir jemanden brauchen, der daraus fertige Stücke macht. Wir suchen uns den, der am besten passt. Diesmal war es Brian Higgins. Unsere neuen Songs sind wesentlich poppiger als die letzten. Lowe: Die Charts spiegeln ja nicht nur die Welt der Musik. Sie sind ein Wettbewerb. Das ist so wie der Eurovision Song Contest. Du machst mit, um zu gewinnen. Tennant: Es sei denn, du bist britisch. Dann gehst du hin, um zu verlieren. SPIEGEL: Higgins produziert ansonsten Girls Aloud, eine der erfolgreichsten britischen Girlgroups. Die kennt aber außerhalb von Großbritannien kaum jemand. Warum? Tennant: Tja, alles wird globalisiert ausgerechnet der Pop ist lokalisiert worden. Auf die Gefahr hin, mir selbst zu widersprechen: Das ist überhaupt nicht gut. Der Grund, warum niemand in Deutschland Girls Aloud kennt, ist ganz einfach: Sie sind nicht auf dem deutschen Markt angekommen. In den Achtzigern wären sie sofort auf dem Cover von Magazinen wie ‘Bravo’ oder ‘Pop/Rocky’ gelandet. Tennant: MTV hat sich verändert. Am Anfang gab es MTV Europe. Das hatte seinen Sitz in London, glücklicherweise für uns Briten. Dann spaltete sich MTV in nationale Sender auf. Man entschied sich gegen die Globalisierung. Die Marke MTV ist zwar überall die gleiche, das Unternehmen auch. Aber der Inhalt wurde national ausgerichtet. Lowe: Jedes Land baut jetzt seine eigenen Stars auf. Deutschland hat seine eigenen Girlbands, seine eigene Castingshow. Wir kriegen Ihre nicht, dafür verschonen wir Sie mit unseren. Tennant: Seit Anfang der Neunziger werden die lokalen Abteilungen der Musikkonzerne angehalten, nationale Künstler unter Vertrag zu nehmen. Das verhindert, dass Künstler international zu einem erfolgreichen Act aufgebaut werden. SPIEGEL: Das ist doch verrückt. War Popkultur, gerade die britische, nicht immer die Speerspitze der Globalisierung? Tennant: Die Plattenfirmen haben aufgehört, global zu denken. Wir gehören zu der vorletzten Generation von britischen Popstars, die, wenn sie einen Hit hatten, als erstes in ein Flugzeug nach Köln gesetzt wurden. Nach uns kamen nur noch die Generation der Boygroups Take That und East 17. Lowe: Unser erster Fernsehauftritt war in Belgien. Und nicht mal in Brüssel. In Ostende.Tennant: Mit ‘West End Girls’. Lowe: Ein großes Thema bei den Ostend Boys. SPIEGEL: Sie haben einmal gesagt, sie hätten das Gesamtprojekt Pet Shop Boys gerne wie einen exklusiven Club, wo Sie sich die Mitglieder aussuchen können. Kann man heute ein Popstar sein, ohne täglich in den Boulevardzeitungen vorzukommen? Tennant: Ich denke schon. Aber es ist schwierig. SPIEGEL: Mr. Tennant, Sie waren Musikjournalist, bevor Sie anfingen, selbst Musik zu machen. Wie sehen Sie die Karriere einer Sängerin wie Amy Winehouse? Hat ihr Celebrity-Status sie nicht zerstört? Tennant: Man muss genau hinschauen. Amy Winehouse hat viele Platten verkauft, ohne dass jemand sie kannte. Die Berühmtheit folgte später. Nehmen Sie die Band Coldplay. Ihr Sänger Chris Martin ist mit Gwyneth Paltrow verheiratet. Als wir bei den Brit Awards waren, unterhielt ich mich nach der Show mit Gwyneth Paltrow, und irgendwann war sie weg. Ich wunderte mich: Warum ist sie ohne Chris Martin gegangen? Dann wurde mir erklärt, dass sie nicht zusammen gehen, damit sie nicht zusammen fotografiert werden können. Sie wollen am nächsten Morgen nicht in den Zeitungen erscheinen. Privatheit kann also gewahrt werden, wenn man will. Chris Martin und Gwyneth Paltrow sind berühmt, auch als Paar. Aber sie haben ihre Sichtbarkeit auf ein Minimum reduziert. SPIEGEL: Sie haben selbst Erfahrungen mit der Kehrseite des Ruhms gemacht. Sie wurden von einer Stalkerin verfolgt. Tennant: Immer noch. Jetzt gerade. Sie schickt mir Nacktfotos. Zuerst war diese Frau hinter mir her, die immer Ballons vor meinem Fenster plazierte. Und als ich die endlich los wurde, tauchte die Neue auf. SPIEGEL: Wie muss man sich das mit den Ballons vorstellen? Tennant: Jeden Morgen, wenn ich aufstand, schwebten Dutzende von Ballons vor meinem Fenster. SPIEGEL: Stand was drauf? Tennant: Nein. Die waren nur da. Die Message war: Ich bin in deinem Leben. Und das stimmte. War sie. Jeden Morgen. SPIEGEL: Dabei machen Sie kein Geheimnis aus Ihrer Homosexualität. Tennant: Das ist egal. Die Stalkerinnen denken immer, das sei etwas, das gelöst werden kann. SPIEGEL: Was machen Sie denn mit Ihrer Post? Viele würden die sicher gerne aus dem Mülleimer fischen. Lowe: Ich kann nicht verstehen, warum Deutschland beim Recycling so viel weiter ist als Großbritannien. Es ist doch so einfach, den Müll zu trennen. Tennant: Der grundlegende Unterschied zwischen England und Deutschland ist ein anderer: Bei Ihnen sind die Geschäfte am Sonntag geschlossen. Sie sagen: An einem Tag in der Woche wird nicht eingekauft. Wenn man das in England machen würde, bräche Panik aus. Lowe: Als wir das erste Mal in Deutschland waren, haben die Geschäfte schon Samstag mittags zugemacht. Tennant: Bei aller Konsumkritik: Das war wirklich zuviel des Guten. SPIEGEL: Mr. Lowe, Mr. Tennant, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Taken from: www.spiegel.de
Interviewer: Thomas Hüetlin und Tobias Rapp