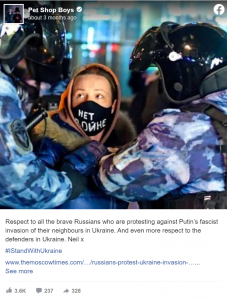Niemand, sagen die Pet Shop Boys. Ihr neues
Album ‘Yes’ rührt bei aller Ironie. Betont kleine
Melodien und bescheidene Rhythmen – ärmliche,
aber saubere Heimorgel-Ästhetik.
Zu viel von allem ist nie genug, du brauchst mehr, du brauchst Liebe, und die kostet nichts: Money can’t buy me love, diese schlichteste und größte aller Popweisheiten wieder einmal in einfache Worte zu fassen und mit seelenwärmendem Disco-Pop zu unterlegen, wer hätte dazu mehr Berechtigung als die alten Pet Shop Boys?
Ihr neues, zehntes Album, das den programmatisch affirmativen Titel Yes trägt (nach den ebenso programmatischen Titeln Please, Actually, Introspective, Behaviour, Very, Bilingual, Nightlife, Release und Fundamental), beginnt damit: Love etc. heißt der Song, und die Gewitzten unter ihren Hörern (also eigentlich alle, denn welcher Pet-Shop-Boys-Hörer ist dumm?) dürfen sich daran freuen, dass unter den aufgezählten überflüssigen irdischen Gütern nicht nur ein Haus in Beverly Hills, sondern auch ein Gemälde von Gerhard Richter ist …
10,5 Millionen Euro hat ein armer Reicher im Februar 2008 für Richters Kerze bezahlt, und doch kann deren Anblick das Gemüt nicht so erhellen wie billige Pet-Shop-Boys-Songs mit ihren betont kleinen Melodien und bescheidenen Rhythmen, ihrer ärmlichen, aber sauberen Heimorgel-Ästhetik.
Vorhersagbar und neu
Eine Kollektion solcher Kleinkunstwerke haben die beiden auch schon älteren Herren Neil Tennant (54) und Chris Lowe (49) für Yes in gewohnter Manier fabriziert, mit so sicherer Hand, dass sich gewiss erfüllen wird, was sie in All Over the World singen: This is a song about boys and girls, you hear it playing all over the world. Die Begründung wird gleich mitgeliefert: It’s sincere and subjective, superficial and true, easy and predictable, exciting and new.
Da schlägt natürlich der Ironiedetektor kräftig aus. Wobei die wirkliche Kunst des Pop à la Pet Shop Boys ist, ironische Reflexion und (echte) Sentimentalität so zusammenfließen zu lassen, dass die Rührung sich trotzdem einstellt. Wenn Neil Tennant auf More Than a Dream, angestachelt von hundertprozentig künstlichen Geigen, seinen Glauben daran beschwört, dass es (die Romanze, das Leben, das wird gar nicht ausgesprochen) mehr als ein Traum sei, schwingt die Armseligkeit dieser Beschwörung mit, und die ist es dann eigentlich, die dem Hörer das Herz zerreißt, wobei dieser Effekt dem Sänger natürlich sehr wohl bewusst ist usw. usf.
So einfach und so kompliziert ist das. Und manchmal scheint die Ironie sogar ganz zu verschwinden: in The Way It Used to Be etwa, einem Lied über die Erinnerung und die Gewohnheit in der Liebe, den Strukturkonservativismus des Herzens. So gewappnet übersteht man am Schluss, in Legacy, sogar den Klimawandel: Seasons will change, more or less, heißt es da, aber: You’ll get over it somehow. Wird schon. Ja.
Taken from: Die Presse.com
Interviewer: Thomas Kramar