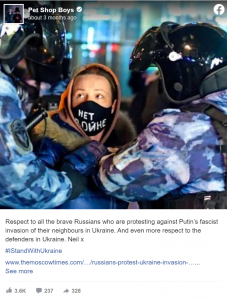Die Pet Shop Boys mit Sergej Eisensteins
‘Panzerkreuzer Potemkin’ in der Alten Oper Frankfurt
Es gibt Bilder, die brauchen nichts weniger als eine Stimme. Sie sind dazu gemacht, durch kurze Texteinblendungen, durch Musik und natürlich durch sich selbst zu wirken. Kein Husten oder Zwischenrufen könnte ärgerlicher sein als eine plötzlich gesprochene Passage in einem Stummfilm. Man braucht sehr gute Gründe für so etwas. Und die von Neil Tennant sind in erster Linie die Erwartungen des Publikums an eine der bekanntesten britischen Pop-Bands, deren Sänger er ist. Sergej Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin richtet seinen Kanonenlauf auf das Opernhaus von Odessa, und Neil Tennant singt dazu ‘Heaven is possible, after all.’ Es ist trotzdem eine der künstlerisch interessanteren Entscheidungen der Neuvertonung durch die Pet Shop Boys, begleitet von den Dresdner Symphonikern: Immerhin handelt es sich um eine Szene voller Dramatik und Dynamik, Druck und Gegendruck, Tod und Ohnmacht.
Tautologien
Ausgerechnet hier keine musikalische Hektik, kein zugespitztes Trommeln, sondern eine utopische Ballade zu hören, zählt zu den wirklich guten Momenten in der Alten Oper Frankfurt, in der die Pet Shop Boys am Freitagabend die Deutschlandpremiere ihre Neuvertonung des Filmklassikers aufführten. ‘Where is the freedom we’ve been waiting for so long’, heißt es an einer anderen Stelle, vollkommen tautologisch zu den Bildern, also überflüssiger Weise. Das ist allerdings insofern auszuhalten, als dass ‘freedom’ aus dem Munde eines Homosexuellen, dessen Jugend zeitlich mit der Thatcher-Ära zusammen fiel, einen bestimmten Klang hat. Die romantische Revolution, zu der die Pet Shop Boys den auf den St. Petersburger Unruhen von 1905 beruhenden Film stilisiert haben, ist ein Leitmotiv ihrer Karriere. Sie stehen für unaggressives, aber explizites Eintreten für die gay community, ohne dabei andere auszuschließen. Frühe Songs wie ‘It’s a sin’ etwa erschließen sich zweimal: Man kann jahrelang glauben, er handele von der ganz normalen aus Film und Fernsehen bekannten verbotenen Liebe, bis er seinen wahren Sinn ganz plötzlich entfaltet und einen erst nach hundert Mal Hören zum ersten Mal wirklich berührt.
Wenn der Tellerwäscher an Bord der Potemkin die frommen Worte ‘Unser täglich Brot gib uns heute’ auf dem Porzellangeschirr der Offiziere erkennt und darüber die Fassung verliert, dann gibt Neil Tennant dem jungen hungrigen Unterdrückten sogar selbst die Stimme. Der, so besehen, in seinem geringelten Matrosenhemd, seiner weißen Mütze und einer noch gänzlich unverdorbenen Empörung irgendwie an die Werbefiguren von Jean-Paul Gaultiers Herrenparfums erinnert. Nur in Verbindung mit den Pet Shop Boys geht so etwas als eine Beobachtung durch, die nicht bloß trivial ist.
Es gibt Momente, da berühren sich die Musik und der Film, wie eine Fingerkuppe vorsichtig in eine gespannte Wasseroberfläche eintaucht, ohne sie zerstören zu wollen. Dann pflügt der Panzerkreuzer nicht gnadenlos durchs Schwarze Meer und die Musik fährt nicht ähnlich unerbittlich nebenher, nur auf einer ganz anderen Spur. Diese behutsamen Momente sind die Augenblicke, in denen kaum etwas zu hören ist für ein paar Takte. Es sind Sekunden von viel größerer Kraft als jedes Crescendo. Wenn die Segelschiffe der Bürger Odessas ausfahren, um Proviant an Bord des Panzerkreuzers zu bringen, dann herrscht ein schöner, gleichmäßiger Rückenwind ohne Trommelschläge. Wenn die Mutter des Babys, das wenig später so spektakulär in seinem Kinderwagen die lange Treppe herunter rollen und auf dem ersten Platz aller Zitate in der Filmgeschichte ankommen wird, stumm aufschreit, springt das Keyboard als Stimme ein mit einer wiederkehrenden, klagenden Melodie. Dass diese im sturen Ostinato immer wieder lippensynchron mit der Stürzenden einsetzt, ist großartig, aber nicht nur den Pet Shop Boys zuzuschreiben. Sondern es zeigt vor allem die mathematische Präzision des Konstrukteurs der Bilder, Eisenstein.
Sergej Eisenstein hat geäußert, er wünsche sich von jeder Generation eine eigene Musik zu diesem Film, den er selbst als ‘meinen ersten Tonfilm’ bezeichnet haben soll, bevor von der Gattung überhaupt die Rede sein konnte. Was die Pet Shop Boys aus ihrer Rolle als Stimme einer Generation, im Auftrag des Londoner Institute for Contemporary Fine Arts, gemacht haben, geht in die Richtung der Idee ‘Classic meets Pop’ aus den siebziger Jahren. Während die Streicher und Bläser der Dresdner Symphoniker in Verbindung mit den Schwarz-Weiß-Bildern erwartbar angemessen klingen, hat der nahtlos in die Partitur eingearbeitete Synthesizer von Chris Lowe etwas Störendes, Irritierendes. Und genau da wäre es interessant geworden. Mit einer Komposition, die nur elektronische Instrumente vorsieht, hätte die Popgruppe Eisensteins künstlerische Radikalität um eine Facette ihrer Zeit erweitern können. Statt dessen klingt alles nach Historisierung und Unentschlossenheit und passagenweise, unvermittelt, nach dem, was man ja sonst auch macht: Mainstreampop.
Als Popmusiker sind die Pet Shop Boys hintergründig, böse und gewitzt, als Künstler der Nachvertonung sind sie zumindest schlau: Nach Ende des Films wird das Leitmotiv noch einmal gespielt, das ohne diese dramaturgische Hervorhebung möglicherweise untergegangen wäre im Meer der Begleitmusik. Doch als Zugabe, dem gemeinhin am gierigsten erwarteten Stück eines Konzertabends, wird mit ‘No time for tears’ noch einmal der Popsong ohne Bilder zelebriert, getragen von der schmeichelnden, immer ein wenig spöttischen und gleichzeitig pathetischen Kopfstimme Neal Tennants und den bekannten, über jene Emotionalität sogleich zuverlässig hinweg stampfenden, dumpfen Rhythmus von Chris Lowe.
Damit haben sich die Pet Shop Boys in den 20 Jahren ihrer Karriere eine einzigartige Akzeptanz auf allen Ebenen erspielt: im Popdiskurs wegen ihrer feinen, auch politisch grundierten Ironie, und auf den Tanzflächen der Clubs wegen der Beats. Die nehmen gegen Ende der Zugabe No time for tears noch mal gewaltig Fahrt auf und machen den Song zur tapfer hedonistisch marschierenden Hymne jener romantischen Revolution. Bis sie, hundert Jahre nach Sankt Petersburg, unverkennbar die Marschrichtung der Zeit vorgeben: Go West.
Taken from: Frankfurter Rundschau
Interviewer: Silke Hohmann