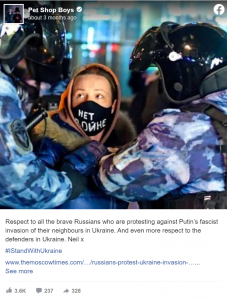Die Pet Shop Boys über ihre Neuvertonung
des Stummfilm-Klassikers ‘Panzerkreuzer Potemkin’,
Politik und Pop
DIE WELT: Lassen Sie uns über Revolutionsphantasien reden. Haben Sie jemals eine so politische Zeit erlebt wie die heutige?
Neil Tennant: Mein Leben war immer hoch politisch. 1972, mit 18, kam ich nach London. Gleich bei meinem ersten Tag am College veranstalteten wir ein Sit-in für gerechte Wahlen in Rhodesien.
DIE WELT: Sie trugen lange Haare?
Tennant: Eigentlich habe ich sie mir nie geschnitten, meine Haare sind irgendwann ausgefallen. Aber wir schweifen ab. In den Siebzigern erstarkten die Sozialisten. Es gab die Streiks der Bergarbeiter. Die Labour Party zerfiel in rechte und linke Flügel. Margaret Thatcher kam. Es änderte sich wirklich alles. 1980 arbeite ich für einen Verlag, es gab Entlassungswellen, wir starteten Aktionen dagegen. Ich war einer der Väter dieser Bewegung. Wir besetzten unsere Büros und schliefen dort. Drei Monate lang. Wir haben Flugblätter entworfen und verteilt.
Chris Lowe: Du warst ein richtiger Aktivist?
Tennant: Genau. Ich habe Reden geschwungen. Robert Maxwell, der Verleger, lud uns schließlich zum Meeting, und am Ende des Meetings fauchte Maxwell: ‘Mein lieber Freund, sieh mich nicht so mißtrauisch an!’
Lowe: Du hattest gute Gründe, mißtrauisch zu sein.
Tennant: Die habe ich immer.
DIE WELT: ‘Panzerkreuzer Potemkin’ war Propaganda. Läßt sich der Film als reiner Klassiker betrachten?
Tennant: Als Kunstwerk. Der propagandistische Furor hat mit den Jahren gelitten wie die kommunistischen Ideale. Ich denke, Ceausescu wäre nicht glücklich gewesen, wenn der Film 1989 mitten in Bukarest gezeigt worden wäre. Der Film handelt von der Kraft der einfachen Leute und richtet sich gegen jede totalitäre Gewalt. Wir haben versucht, den Film im Iran zu begleiten. Die wollten das nicht, wir sollten Pet-Shop-Boys-Hits spielen.
Lowe: Die sind da wählerisch.
DIE WELT: Sie haben Ihren ‘Potemkin’ auf dem Londoner Trafalgar Square uraufgeführt, dem Platz der britischen Manifestationen. Ein politisches Statement?
Tennant: Trafalgar ist der zentrale Platz für Proteste in London. Er hat große Proteste gesehen. Die Regierung Thatcher verschwand 1990 nach den Poll Tax Riots. Zuletzt wurde hier gegen den Irak-Krieg demonstriert. Wenn man dort eine Bühne aufbaut und eine Leinwand, hat das schon aus der Geschichte heraus politisch etwas sehr Theatralisches. Wenn man sich unmittelbar nach den Anti-Kriegs-Aufmärschen ins blutige Jahr 1905 nach Petersburg versetzt. Aber uns geht es eher darum, den Akt des Protests zu ästhetisieren.
Lowe: Ich empfand es unmittelbar politisch. Es war Kunst gegen die Regierung und ihr Engagement im Irak.
DIE WELT: In vielen reichen Industrienationen verlieren Industriearbeiter ihre Jobs und fühlen sich von sozialistischen Parteien im Stich gelassen. Eine beinahe klassische revolutionäre Situation.
Lowe: Wir wissen doch gar nicht, wie das geht: Revolution.
Tennant: Revolutionen sind keine gute Idee. Sie entwickeln ihren eigenen Schwung und gehen immer gefährlich über das Herstellen besserer Zustände hinaus. So war das in Frankreich. Die russische Revolution war ein phänomenales Desaster für Rußland. China. Nordkorea. Ich glaube nicht an Revolutionen. Sie sind ein phantastischer menschlicher Irrtum.
DIE WELT: Revolution bleibt ein popkulturelles Sehnsuchtswort.
Tennant: Woran leiden die Arbeiter am meisten? An der eigenen ökonomischen und politischen Verwirrtheit.
DIE WELT: Mick Jagger fragt in ‘Street Fighting Man’: Was kann ein armer Junge schon tun, außer in einer Rockband zu spielen? Können Popstars politisch mitreißen?
Tennant: Ich denke, gute Politiker können das. Ich glaube und vertraue keinen Popstars.
DIE WELT: Sie glauben an Politiker?
Tennant: Wir sollten das, ja. Wenn Menschen nicht an Politiker glauben, dann vertrauen sie fragwürdigen Figuren. Ich erinnere an den italienischen Faschismus, an Hitler. Niemand sollte demokratischer Wirren überdrüssig sein. Dieses System reflektiert das Leben, wir sollten also zu unseren Politikern halten. Als Politiker mußt du heute so tough sein wie nie zuvor. Du wirst unablässig persönlich angegriffen, nicht nur politisch. Nun müssen wir mit diesen unglaublich dickhäutigen Politikern leben.
DIE WELT: Politiker müssen sich als Stars verkaufen?
Tennant: Ach, nein. Wenn man Bono von U2 bei Konferenzen neben Tony Blair sieht, dann erkennt man schnell den Unterschied, auch wenn Bono sich als Popstar für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Dieser empfindsame Idealismus macht sich übrigens gut im Pop. Ob er auch gut ist für die Popmusik, ist eine ganz andere Frage. Nehmen wir Bob Geldof: Er ist ein guter Politiker, aber ein miserabler Rockstar. Wenn Stars über Politik reden, sind deren Platitüden noch furchtbarer und langweiliger, als die der Politiker.
DIE WELT: Warum haben Sie für Bob Geldofs Live 8 ausgerechnet in Moskau gespielt?
Tennant: Kurzfristig und kurzentschlossen. Die Russen bekamen erst spät Putins Erlaubnis. Außerdem sind wir nicht die großen Life 8-Kandidaten. In Rußland setzt man sich einem geringeren Verdacht aus, sein CD-Geschäft anheizen zu wollen. Russen kaufen raubkopierte CDs. Im Hyde Park zu spielen erregt schon wieder diese geschäftliche Aufmerksamkeit. Es gibt keine größere Werbeveranstaltung als Live 8. Natürlich möchte ich festgehalten wissen, daß es eine großartige idealistische Veranstaltung ist. Ich mag diese Protestelemente. Und natürlich waren auch wir global im Fernsehen zu sehen.
DIE WELT: Raubkopierte CDs sind eine Art von Kommunismus im Musikgeschäft.
Tennant: Oh, nein. Sie sind eine äußerst primitive Form von Kapitalismus: Die Arbeiter werden bestohlen, nämlich wir, und der ganze Profit wird einbehalten.
DIE WELT: Zum Moskauer Live 8-Finale spielten Sie ‘Go West’. Eine Schwulenhymne, die gern auch in Fußballstadien gegrölt wird. Nun gibt der Song dem ehrgeizigen Osten die weltpolitische Richtung vor.
Tennant: Uns war aufgefallen, daß ‘Go West’ erstaunliche Ähnlichkeiten mit der sowjetischen Nationalhymne aufweist. Es macht ästhetisch und politisch Sinn, wenn die Russen heute ‘Go West’ auf dem Roten Platz singen.
DIE WELT: Pop gilt als Soundtrack des Kapitalismus. Wir erinnern an Ihren alten Song: ‘Opportunities …’
Tennant: ‘… Let’s make lots of money.’ Pop sei die Kultur des Kapitalismus – das ist eine alte, hohle Phrase. Man muß das für alle Zeiten anders sehen: In den fünfziger Jahren entwickelte sich Pop mit der Nachkriegsprosperität. In den Achtzigern veränderte sich Pop durch Gestalten wie Margaret Thatcher. Unser ‘Opportunities’ war eher ein Punksong und stand mit Wut und Ironie außerhalb des Musikgeschäfts. Was das Geschäft selbstverständlich nicht daran hinderte, den Song aufzusaugen und in seine Maschinerie einzuspeisen. Gut, uns hat das genützt.
DIE WELT: Sie glauben also auch nicht an kulturelle Revolutionen wie Punk.
Tennant: Popmusik erzählt davon, wie wir unser Leben verbringen. Es geht um Attitüden, am liebsten sexuelle. Diese Haltungen ändern sich, mitunter enorm. Es ging bereits um Antimaterialismus, um Umwelt, um Schwule. Manches war antikapitalistisch, anderes weniger oder gar nicht. Stars haben immer neue Maßstäbe für das Normale gesetzt. Musik war ihr aufgebrachtes Medium und am leichtesten zu entschärfen. Nehmen wir Bruce Springsteen: Der trat so deutlich auf, im Blaumann des Arbeiters. Das hat es Ronald Reagan erleichtert, ‘Born in the U.S.A.’ als Wahlkampfhymne zu okkupieren. Pop hat seine widersprüchlichen Bedeutungen. Schon deshalb kann er nie wirklich revolutionär sein. Nur harmlos.
DIE WELT: Oder sind die Fans zu einfältig, um Botschaften zu verstehen. ‘Born in the U.S.A.’ war für viele eine patriotische Hymne und kein gebrochenes Lied für bedauernswerte Vietnam-Veteranen?
Tennant: Da haben wir’s: Das ist Bruce Springsteens Fehler. ‘Born in the U.S.A.’ erzeugt eine bombastische Stimmung, mehr nicht. Es ist nicht so gemeint, aber es klingt so. Und das interessiert die Leute zuerst. Mich auch. Außerdem ist das Teil des Vertrages, den wir mit dem Popstar eingehen. Wir ernähren ihn dafür, daß er uns einfache Botschaften vermittelt, daß wir uns darüber freuen und uns nicht beschweren.
DIE WELT: Wir nehmen hiermit endgültig Abschied vom politischen Musiker.
Tennant: Wie soll ein Musiker etwas schreiben gegen den Krieg im Irak? Und das dann auch noch vor Promis in den Konzerthallen Londons aufführen, übertragen von der BBC? Es geht einfach nicht. ‘Street Fighting Man’ von den Rolling Stones war kein politischer Song, sondern ein Lied, das dem Zeitgeist hinterschrie. Der ehrlichste Song bleibt John Lennons ‘Revolution’, weil er vom Zweifel an Revolutionen handelt. Man war neugierig aber skeptisch. Übrigens: Hat jemand je einen vernünftigen Song über das Live 8-Thema Afrika geschrieben?
DIE WELT: Die Specials mit ‘Free Nelson Mandela’.
Tennat: Ah! Erwischt. Gut, das ist der einzige, wirklich der einzige so großartige wie politisch erfolgreiche Popsong aller Zeiten. Er hat Mandela berühmt gemacht. Ich hatte bis dahin nie etwas gehört von ihm. Dann war er frei.
DIE WELT: Sie haben Remixes für Rammstein angefertigt. Rammstein machte sich einen Namen durch die Verwendung von Leni Riefenstahls Olympia-Film für einen Videoclip. Würden Sie auch Riefenstahl vertonen?
Tennant: Komisch, daß Sie das fragen, wir haben erst neulich darüber diskutiert. ‘Potemkin’ erschien uns immerhin auf den zweiten Blick als brillanter Film. Bei Riefenstahl bleibt es Propaganda, so gut die auch gemacht sein mag. Es geht um die Bewegung, um Heldentum, um den Führer. Bei ‘Potemkin’ geht es um Brüderlichkeit und darum, daß sich dadurch manches bewegen und verändern läßt. Ich weiß schon: Eisenstein und Riefenstahl waren beide große Modernisten im Stil. Aber ich habe ‘Triumph des Willens’ gesehen. Die Menschen sehen so ausdruckslos aus, so grotesk. Die Sterne über Nürnberg sind beeinduckender als die Menschen. Der Film riecht, entschuldigen Sie das Klischee, nach kaltem Krauteintopf. Wenn sie bei ‘Potemkin’ genau hinsehen, hat der Film sogar Humor. Der betrunkene Priester ist komisch: gewissermaßen ein Ire auf einem russischen Kriegsschiff, großartig, christlich und antichristlich.
DIE WELT: Eisenstein hat sich ausdrücklich alle zehn Jahre einen neuen Soundtrack gewünscht. Ändert die Musik tatsächlich die Aussage des Films?
Tennant: Wenn wir die Botschaft des Films darin sehen, daß er für die Freiheit plädiert, dann bemühen wir uns darum, das durch die Musik zu verstärken. Und wenn Sie den Film mit der ursprünglichen Musik von Schostakowitsch sehen und dann mit unserer Musik, sollten Sie schon einen völlig anderen Eindruck des Films haben. Wenigstens einen Eindruck von Modernität. Das wird die Popmusik wohl noch leisten können.
Taken from: Die Welt
Interviewer: Michael Pilz