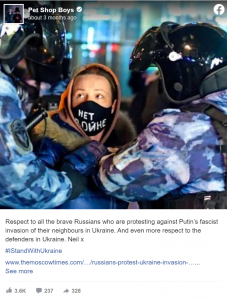Moby im Heimathafen Neukölln und die Pet Shop Boys im Tempodrom:
die Neunziger Jahre waren zu Gast in Berlin, einmal auf die tragische Art
und einmal auf die beeindruckende. Zwei Konzertkritiken zum Preis von einer.
ie Schwarzmarkthändler sind bei den größeren ausverkauften Konzerten ja meistens die gleichen, und man durchschaut sie auch recht schnell: gut organisiert ähnlich der Hütchenspieler-Mafia, meist zu dritt oder viert unterwegs einer (Typ: Fan der Band, zwischen studentisch und pleite) sucht mit handgeschriebenem Schild ein Ticket, das er im Erfolgsfall (Kauf zum Originalpreis) seinem Kollegen (Typ: Sakko und Umhängetasche, Jeans) weitergibt (manchmal über den dazwischen aufgebauten Brezel-Verkaufsstand), der es wiederum weiter vorn über die Mitleidsmasche (selbst zu teuer bei ebay gekauft, Kumpel hat abgesagt) zum ungefähr doppelten Preis an verzweifelte echte Fans der Band verkauft. Beim Konzert von Moby letzte Woche standen sie, genau wie zwei Tage später beim Konzert der Pet Shop Boys, und ging man mit halbwegs offenen Augen zu diesen beiden Konzerten, sah man das nicht als einzige Gemeinsamkeit.
Moby im Neuköllner Heimathafen, einer gemessen am ehemaligen Starkult rund um den Amerikaner mit zirka 600 Personen Fassungsvermögen eher kleinen und in Berlin auch unüblichen Konzertlocation, die entsprechend schnell ausverkauft war, nicht nur weil es eines von nur drei Solokonzerten in Europa für Moby sein sollte. Das neue Album Wait for me im Gepäck, man kennt das, ganz klassisch Live als Unterstützung für den Plattenverkauf, im Jahr 2009 schon fast eine anachronistische Geste, läuft es mittlerweile doch meist umgekehrt. Überhaupt, der 90er-Flashback: das Publikum im Schnitt Mitte 30, der Saal durchaus nicht komplett gefüllt, daher fast überall gute Sicht und guter Sound. Selten genug. Und auch überall drumherum permanent das Gefühl, beim Einlass durch eine Zeitmaschine gegangen zu sein: Getränkepreise auf ordentlich-angenehmem Neukölln-Niveau, als Security keine kurzhaarigen Anabolika-Kampfmaschinen, sondern ältere Herren im Anzug mit Namensschildchen, ursprünglich vermutlich als Platzanweiser gecastet. Schick.
Das Problem nur: der 90er-Flashback blieb auch während des Konzerts bestehen. Ein Moby-Konzert ist Chefsache, jener Chef dirigiert also die restlichen sechs Bandmitglieder mit sichtbar verkniffenem Gesichtsausdruck, fast möchte man sagen neurotisch, und wäre da nicht noch Joy Malcolm mit ihrer erwartungsgemäß beeindruckenden (aber dadurch eben auch nicht wirklich überraschenden) Soulstimme, wäre das Treiben auf der Bühne ein ziemlich manisch-männliches geblieben Muckertum, dem man eigentlich auch noch Gitarren- und Drum-Solos zugetraut hätte. So aber gab es immerhin eine Band zu sehen, die ja, was denn, eigentlich? Eine Band, die die Moby-Hits und Songs vom neuen Album nachspielte. Natural Blues und Go waren dabei, Were All Made Of Stars natürlich auch, die eine oder andere Coverversion selbstverständlich. Fast wünscht man sich einen Affront des Publikums, um wenigstens ein bisschen überrascht zu werden. Als Wohlfühlsoundtrack zur Dotcom-Blase beschreibt Jörg Wunder im Tagesspiegel die bekannten Hits, und genau so wirkt dann leider auch jedes Detail: als damals wars nett, aber heute könnten das andere besser. Ein bisschen Soul, ein bisschen Elektronik, ein bisschen Ambient-/Klangteppich, ein bisschen Ohrwurm klar, angenehm, schön, aber dann eben doch irgendwie ohne Relevanz für das, was Musik im Jahr 2009 stehen sollte. Für das, wofür ein Künstler wie Moby mit all seinen Weltverbesserungsabsichten im Jahr 2009 eigentlich stehen müsste.
Nichts davon war schlecht, nichts davon war so, dass man das ausgegebene Geld bereut hätte, aber ich war auch nicht der einzige, der sich oft eher ratlos umgesehen hat: da hätte eine Moby-Coverband auf der Bühne stehen können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Und die Belanglosigkeit im Auftritt passte dann doch wieder zum Setting und Publikum: bei den Hits im Takt mitklatschend als wäre man bei Wetten, dass..?, und auch sonst eher dancend als tanzend, als wäre man auf einer Ü30- oder Afterwork-Party und nicht auf einem Konzert. Ist es anmaßend, wenigstens ein kleines bisschen Innovation zu erwarten? Auf ein kleines bisschen Wow! oder wenigstens Uff! zu hoffen? Es blieb bei einem überflüssigen nein, nicht mal überflüssig, sondern: es wurde ein egaler Abend, der dem Albumtitel Wait for me einen eigenartigen Subtext verlieh. Moby rennt den Nuller Jahren hinterher.
Mit schlimmsten Befürchtungen also zwei Tage später auf dem Weg zu den Pet Shop Boys ins Tempodrom, denn das Argument es kann eigentlich nur besser werden war ja noch nie ein haltbares. Jedenfalls nicht, wenn eine Band für einen so beträchtlichen Teil der eigenen musikalischen Sozialisation verantwortlich ist wie das bei den Pet Shop Boys der Fall ist. 4000 Leute im ausverkauften Tempodrom, nicht ganz so kuschelig wie bei Moby also, aber kein Hallen-Monster wie die Treptower Arena oder, Gott bewahre, eines dieser seelenlosen Sponsorennamen-Mehrzweckhallen-Ungetüme. Aber auch Gemeinsamkeiten: gleiche Zielgruppe und ähnlicher Altersschnitt wie zwei Tage zuvor. Und dass für ein Konzert -teilweise- Sitzplatztickets verkauft wurden, dass ein Konzert von Antenne Brandenburg präsentiert wird, und dass die Vorband unerträglich schmalzigen Deutschpop-Chansonschlager (think bastard child of Tele & Anajo) macht, so dass man ihren Namen sofort wieder vergisst all das verheißt normalerweise auch nichts unbedingt gutes.
Aber!
Da waren ja schließlich noch die Pet Shop Boys. Neil Tennant und Chris Lowe, deren Bild beim Stichwort perfektionierte musikalische Kulissenschieberei vor dem geistigen Auge auftaucht (und das vermutlich sogar im 90er-Jahre-Styling mit Boy-Cap).
(
) könnten wahnsinnig viel falsch machen, fast wartet man auf eine geschmackliche Entgleisung. Sie könnten zum Beispiel Pyrotechnik einsetzen. Sie könnten nackte Tänzer mit Engelsflügeln sich abseilen lassen. Sie könnten auch über schmale Laufstege ins Publikum schreiten oder einfach zu viel sprechen. Aber sie tun das alles nicht. Nach 14 Platten und 23 Jahren Bandgeschichte hat man hat schließlich einen Ruf zu verlieren.
( Esther Kogelboom im Tagesspiegel)
Nicht, dass dieser Vergleich notwendig wäre, aber: Alles, was man Moby anlasten könnte, haben die Pet Shop Boys an diesem Abend nämlich richtig gemacht. Auch sie sind eine 90er-Band, auch sie spielen zu einem Großteil Best-Of-Shows (wie man das in der Depeche-Mode- oder eben Moby-Größenordnung nun mal so macht), also neben den durchaus vorhandenen aktuellen Songs und Single-Auskopplungen (sagt man dazu eigentlich wirklich noch Auskopplungen?) eben die Tracks der eigenen musikalischen Geschichte, die von Tracks zu Songs und von Songs zu Hymnen wurden (und von Hymnen wieder zu Kult, von Go West mal abgesehen, das von der Hymne zum Kitsch wurde).
Aber die Pet Shop Boys machen dann eben auch nicht jenen Fehler, sich auf die Greatest Hits zu verlassen: der schmale Grat zwischen dem Sitzplatzpublikum die neue Single abspielen und den seit-20-Jahren-Fan-Fans eine Freude machen wurde nie verlassen und wenn, dann höchstens so, dass jede der beteiligten Zielgruppen ihren Spaß daran hatte, etwa wenn aus der (neuen) Single Pandemonium und dem Klassiker Can You Forgive Her mal eben ein Mashup gemacht wurde, genau wie aus Closer To Heaven und Left To My Own Devices. Oder dass die Show mit Heart eröffnet wurde und nicht mit Love Etc., oder dass in einem anderen Track ein Sample aus Paninaro (kurz angespielt) versteckt wurde.
Für die Antenne-Brandenburg-Hörer Go West, für die Setlist-Nerds das zuletzt auf der 1991er-Tour gespielte Jealousy. Für alle im Saal Being Boring (einen der wenigen mir bekannten Songs, dem eine vollständige Website gewidmet ist), für mich Kings Cross. Und all das zu einem Stagedesign und während einer Choreographie, die ebenso scharf auf der Grenze zwischen Clubkonzert und Mega-Event balancierten: technisch perfekt, und trotzdem mit Seele. West End Girls zum Abschluss und das Versprechen, im Dezember wieder nach Berlin zu kommen, und ein Großteil der Anwesenden wäre noch am gleichen Abend Karten kaufen gegangen, hätte es schon welche gegeben.
Sogar aus den hinteren Reihen konnte man an einigen Stellen während des Konzerts das ganz subtil angedeutete Lächeln im Gesicht Neil Tennants erkennen, eines dieser Lächeln, das man aus Männerfreundschaften kennt, wenn man nicht viel miteinander reden muss, aber sich eben auch ohne große Worte versteht. Das Publikum wusste, daß die Pet Shop Boys wissen, dass es (das Publikum) sich über bestimmte Songs freuen würde, und das wiederum wussten die Pet Shop Boys und das ist im echten Leben gar nicht so kompliziert, wie es sich jetzt liest. So war das jedenfalls zwischen den Jungs auf der Bühne und dem Publikum an diesem Abend: Verbundenheit. Sowas bekommt ein Moby einfach nicht hin.
Taken from: Solokarpfen.de
Interviewer: Frank Lachmann